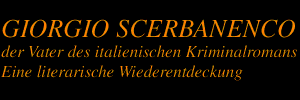
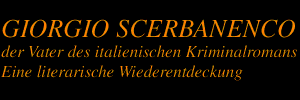
![]()
Mordano, 19. Juli 1999
Sehr geehrter Herr Scerbanenco,
ich bin ein treuer Leser Ihrer Bücher und schreibe Ihnen, um Ihnen zu sagen, dass sie mir sehr gut gefallen haben. Ich habe sie nicht alle lesen können, da Ihre Bibliographie beinahe hundert Romane und tausend Erzählungen umfasst, die vom Thriller bis zum Liebesroman reichen und dabei sowohl sehr persönliche autobiographische Texte wie klassische Kriminalromane einschließen, doch das, was ich gelesen habe, hat mich derartig begeistert, dass ich Ihnen einfach schreiben musste, wobei ich mich im Voraus für die Zeit, die ich Ihnen hierdurch raube, entschuldigen möchte.
Ich weiß noch, dass ich vierzehn Jahre alt war, als ich das erste Mal ein Buch von ihnen las. Es war 1974, Sie waren seit fünf Jahren tot, und es war an einem Sonntag Nachmittag, an dem ich zu allem bereit war, um bloß keine Hausaufgaben machen zu müssen. Das beste Alibi war immer, mit einem Buch beschäftigt zu sein, aber im Bücherschrank meines Großvaters, bei dem ich zum Mittagessen war, stand nichts Brauchbares. Da sehe ich plötzlich zwei seltsame Augen, die mich schräg und stilisiert vom Einband eines Garzanti-Krimis anstarren, direkt über dem Titel I ragazzi del massacro. Ich nehme es heraus, schlage es auf und lese den Anfang. „Fräulein Matilde Crescenzaghi, Tochter der verstorbenen Michele und Ada Pirelli, ledig, unterrichtete an der Abendschule Andrea und Maria Fustagni", das reißt mich nicht gerade vom Hocker, denn der förmliche und pingelige Ton erinnert mich an Jugendbücher wie Cuore, doch dann kommt der Schluss des Prologs:
„Die Klasse wäre besser von einem Major der Fremdenlegion beaufsichtigt worden und nicht von diesem zarten, sensiblen Fräulein aus dem Kleinbürgertum Norditaliens." Das macht mich neugierig und ich blättere um. „Sie ist seit fünf Minuten tot, sagte die Nonne", klassischer Auftakt eines Kriminalromans, auf den eine der härtesten und umbarmherzigsten Seiten folgt, die jemals in einem Roman geschrieben wurden. Von dem Moment an konnte ich das Buch nicht mehr weglegen, ich war gefesselt, fasziniert und erschüttert von einer Realität, die mir fremd war, von verborgenen Winkeln des menschlichen Herzens, deren Existenz für mich vollkommen neu war, von einem so schrecklichen, melancholischen und verzweifelten Geheimnis, das auf eine Weise geschildert war, die ich nie für möglich gehalten hatte, mit denselben schlichten, direkten und rohen Worten wie die, die mir am Anfang so förmlich und präzise erschienen waren. Ich machte zwar keine Hausaufgaben mehr, bekam beim Abfragen eine schlechte Note und schloss am Ende nicht einmal mein Studium ab, aber ich habe alle Ihre Roman gelesen, die diesem ähnelten und bin auch Schriftsteller geworden. Wissen Sie, was mich an Ihren Romanen am meisten beeindruckt hat? Der Mut. Verschiedene Arten von Mut, hartnäckig, stumm und kalt, leicht autoironisch, so wie Sie auf den Fotos mit Ihrem schmalen Lächeln unter der wie ein Schnabel gebogenen Nase. Der Mut des Widerspruchs, zum Beispiel. Ihre bekannteste Romanfigur, der Held von vier Romanen, Duca Lamberti, ist ein lebender Widerspruch. Zum ersten Mal taucht er im März 1966 auf, in Venere privata (dt. Das Mädchen aus Mailand), und er ist ein merkwürdiger Polizist. Er ist nämlich eigentlich gar kein Polizist, sondern ein Arzt, nein, ein Arzt ist er auch nicht. Er war einer, bis ihm für immer die Zulassung entzogen wurde und er für drei Jahre ins Gefängnis kam, weil er bei einer alten, krebskranken Patientin Sterbehilfe geleistet hatte. Auf den ersten Seiten des Romans sitzt er auf einer Bank und vertreibt sich die Zeit damit, die Kieselsteine auf dem Weg zu zählen wie im Gefängnis, während er auf einen ungeschlachten
Provinzindustriellen wartet, der ihn als Babysitter für seinen „großen, aber etwas beschränkten" Sohn engagieren will, der sich aus unerklärlichen Gründen zu Tode säuft. Doch es gibt einen Grund für das Verhalten des Jungen, ein schreckliches Geheimnis, das Duca lösen muss, wenn er den Jungen retten will. Also verwandelt er sich in einen Polizisten, aber einen seltsamen Polizisten: draufgängerisch, brutal, auf den ersten Blick zynisch, und zugleich zerbrechlich, unruhig und hoffnungslos sensibel. Duca ist nicht so abgebrüht wie seine amerikanischen Kollegen, er ist ein Italiener, der viel durchgemacht hat und darunter leidet. Als Polizist ist er wirklich seltsam. „Da es für die Toten kein Zurück gibt und weder ich noch irgendein anderer Alberta wieder zurückbringen kann", sagt er zum Sohn des industriellen, „müssen wir uns eben etwas anderes ausdenken. Das Wichtigste wäre es, denjenigen zu finden, der sie ermordet oder zum Selbstmord gezwungen hat. Und wenn wir den finden, erdrosseln wir ihn. Daran müssen Sie denken: Wir erdrosseln ihn." Sie erdrosseln ihn nicht, und im darauffolgenden Roman, Traditori di tutti, der noch im selben Jahr erschien, wird Duca vom Polizeipräsidium von Mailand eingestellt, wo er auch in I ragazzi del massacro (August 1968) und I milanesi ammazzano al sabato (April 1969) bleiben und, von den Widersprüchen Italiens berichten wird, wie sie heute noch bestehen.; dein Italien der armen Schlucker, der Außenseiter, der Durchgedrehten und der Gleichgültigen, die in den Falten eines vom Wirtschaftswunder betäubten Landes mit den ersten Waschmaschinen und den ersten Fiat Seicentos verschwinden, dem Italien einer neuen und absurd brutalen Kriminalität, die keine Furcht und keine Scham mehr kennt, dem Italien der Machthaber, der politischen Deckungsmanöver und der Vertuschung, der anständigen Leute, die „schmerzerfüllt und verzweifelt" sind wie Amanzio Berzaghi, der alteingesessene Mailänder Lastwagenfahrer, der weiß, dass Morden „nicht richtig ist, aber an einem wunderschönen nichtsahnenden Novembersamstag" die Nerven verliert. In diesem so modernen und aktuellen Italien sucht Duca die „Gauner", die sich nicht an die Regeln halten, „die Banditen mit dem Anwaltsbüro nebenan", die „betrügen, stehlen und töten, aber für den Fall, dass sie entdeckt und vor Gericht gestellt werden, immer schon die Verteidigungsstrategie mit ihren Anwälten besprochen haben und niemals genug bestraft werden." Er sucht sie mit solchem Hass und solcher Entschlossenheit, dass er sogar für einen Faschisten gehalten wird. Verzeihen Sie mir, aber neulich in Frankreich habe ich das auch über Sie sagen hören: „Scerbanenco, ist das nicht ein Faschist?" Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, das ist die Wut und die Verzweiflung eines Menschen, der „zu viel Elend" gesehen hat, wie Sie in einem wunderbaren Fragment Ihrer Autobiographie schreiben, das unter dem Titel lo, Vladimir Scerbanenco am Ende der Garzanti-Ausgabe von Venere privata steht. Die Haltung eines Russen mit italienischer Mutter, dessen Vater während der Revolution erschossen wurde, eines Römers aus Kiew mit einem K zu viel im Nachnamen, der sich in einem Land, das ihm fremd ist, durchschlägt und akzeptiert werden will, als Dreher in einer Weckerfabrik, als autodidaktischer Philosoph, als Sanatoriumspatient, als Rettungshelfer und später Buchhalter beim Roten Kreuz, und schließlich als Autor, Redakteur und Direktor von Frauenzeitschriften, als Schriftsteller. Vielleicht sind es auch die Vorurteile eines Mannes, der vor den Achtundsechzigern und allem, was dazu gehörte, starb und gelebt hatte. Aber kein Faschist. Es gibt noch eine andere Art von Mut in seinen Büchern, und das ist der Mut, die Dinge beim Namen zu nennen. Etwas, was man in der italienischen Literatur nicht oft findet, bis vor kurzem nicht einmal in der Genreliteratur und heute weniger denn je in Film- oder Fernsehproduktionen. Keine Filter mildern eine Realität, die genauso verzweifelt, brutal, nackt und roh ist wie etwa die in den bekannteren Romanen von James Ellroy oder Jim Thompson. Keine Entschuldigung, kein Kompromiss, kein Held ohne Makel, angefangen bei Duca Lamberti und seinen Kollegen vom Polizeipräsidium. „Wie habt ihr es herausgefunden?" „Mit Ohrfeigen. Mascaranti hat ihn verhört. Wenn die ihre Dinger drehen, denken sie nie an Ohrfeigen. Es braucht keine chinesischen Foltermethoden, bei der fünftenoder sechsten von Mascarantis Ohrfeigen muss man sich entscheiden, ob man will, dass einem das Gehirn ausläuft." Das ist weder schön noch gut, das sagt auch Duca, das sagen auch Sie, aber so geschieht es eben und so wird es erzählt. Die Dinge beim Namen nennen mit einem Stil, der immer so schnell und konkret ist, dass er bisweilen skizziert wirkt oder grammatikalisch falsch, aber das ist er nicht, alles ist wohlüberlegt und dabei wird kein einziges Wort übersehen, auch nicht die Eigennamen. Wie in Lussuria/Wollust, einer der fünfhundert Erzählungen, die Frassinelli in dem vergriffenen Band Il Cinquecentodelitti/Fünfhundert Verbrechen veröffentlicht hatte, wo eine Frau eine Zeugenaussage macht, „mit einem grauen Kleid, das eher wie eine Schürze aussah, einem Gesicht, das ebenso grau war wie das Kleid, ebensolchen Haaren und einer Stimme, die auch grau klang". Wie sie heißt? Erminia Lavini, ein ungewöhnlicher Name, aber kein ausgefallener, einer, der klingt, als habe man ihn zu oft gewaschen. Und dann gibt es noch eine Art von Mut, eine besonders wichtige: den Mut, ein Erzähler zu sein. Ein Erzähler, einer, der Geschichten erzählt, nichts weiter als ein Schriftsteller, wie wir sagen würden, aber das tut nichts zur Sache. Einer, der auf die Trennlinie zwischen Literatur und Unterhaltung pfeift, und der mit der handwerklicher Präzision ,und glühender Leidenschaft schreibt, ,jede Woche, um nicht zu sagen, jeden Tag, um nicht zu sagen, jede Stunde", wie Oreste del Buono in seinem Vorwort zu Millestorie/Tausendgeschichten (Frassinelli) schreibt, „brachte er eine Geschichte mit einer Handlung und Figuren hervor, die sich auf rührende Art und Weise im Gedächtnis festsetzten". Geschichten, wahre und außergewöhnliche Geschichten, selbst wenn sie extrem reduziert sind, Erzählungen von wenigen Zeilen, aber so dicht, dass sie das Kernstück einer mehrere hundert Seiten langen Romans bilden könnten. Geschichten, die er von jenem elenden Dasein gelernt hatte, die die Sensibilität des Schriftstellers ihm diktierte oder die aus den Jahren stammten, in denen er Leserbriefe beantwortete, vor sich die Schreibmaschine einer Frauenzeitschrift wie in einem weltlichen Beichtstuhl. Geschichte, die man erzählen muss, ohne viel Umschweife. Sie sagen das mit Ihrer üblichen Bescheidenheit, und es klingt beinahe einfach. „Der Laie denkt, die Inspiration sei etwas Magisches (...) Es ist sehr schön, wenn man sich einen Dichter vorstellt, wie er den blauen Himmel betrachtet und auf eine Eingebung wartet. Aber so ist es nicht. Man schreibt, wenn man schreiben will, und eine Eingebung gibt es wahrscheinlich gar nicht. Wie bei allem, was man macht, muss man einfach Lust haben zu schreiben, Spaß daran haben. Auch um einen Berg Wäsche zu bügeln oder einen Pullover zu stricken, muss man dazu aufgelegt sein oder Spaß daran haben (...) Mir macht eben das Schreiben Spaß." Tja, das haben wir gesehen. So wie wir seinen Mut beim Umgang mit der Genreliteratur und ihren Regeln gesehen haben. Indem er den Kanon des Krimis und des Thrillers immer wieder betritt und wieder verlässt, die Regeln missachtet, Handlungen konstruiert, die auch dann spannend sind, wenn sie naiv sind - wie bei Raymond Chandler - , sich selbst in den härtesten Erzählungen zarte Gefühle erlaubt, und schließlich -zig Schnulzen und hunderte von Liebesromane schreibt, auf alle Schubladen und Normen pfeift, wenn nicht die, für jede Geschichte die beste Art und die wirksamste Erzählstruktur zu wählen. Denn die Geschichten sind wichtig. Auch das sagen Sie deutlich in Io, Vladimir Scerbanenco, und Sie sagen es mit der Technik eines erstklassigen Krimiautors. Sie bekommen einen Brief von einer Leserin, die sich umbringen will, Sie antworten Ihr mit der ganzen Überzeugungskraft, zu der ein Schriftsteller fähig ist, mit den richtigen Worten, den richtigen Argumenten, allem, aber sie versucht trotzdem, Selbstmord zu begehen. Ist also die Literatur unnütz? Ist es also vollkommen unnütz, die Widersprüche und Heucheleien der Gesellschaft niederzuschreiben, zu erzählen, zu kritisieren, anzuprangern, wie Sie es getan haben, wie es Krimiautoren tun, wie wir es tun? Als ich diese Zeilen las, war ich enttäuscht, aber kurz darauf kommt eine überraschende Wendung. „Nur ein einziges Mal noch spürte ich in einem Brief diese durchdringende Todessehnsucht." Sie antworten, wie das letzte Mal, und die Frau schreibt, sie sei Ihnen zwar dankbar, aber sie würde sich trotzdem umbringen. Sie schreiben ihr weiterhin, und die Frau antwortet, und auch wenn sie sagt, sie wolle sich umbringen, schreibt sie auch weiter. „Letztes Jahr bekam ich noch einen Brief von ihr. Diesmal war es den Worten gelungen, den Wunsch zu stoppen, die ausgestreckte Hand vor der Lokomotive hatte den fahrenden Zug aufgehalten. Manchmal passiert das, und dann denke ich, dass meine Arbeit als Schriftsteller nicht unnütz ist." Ich grüße Sie herzlich und bitte noch einmal um Entschuldigung für die Zeit, die ich Ihnen geraubt habe. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, Ihr
Carlo Lucarelli
(aus der Zeitschrift „Pulp",
Pavia, September-Oktober 1999)
Beachten Sie bitte auch die weiteren Verlagsangaben zum aktuellen Roman »Das Mädchen aus Mailand«. Klicken Sie hier! >>>